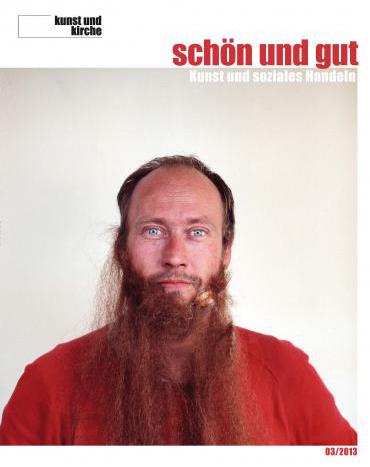schön und gut - Kunst und soziales Handeln
„Schön und gut! – Aber…“– so fügen sich umgangssprachlich das scheinbar Selbstverständliche und sein Widerspruch aneinander. Denn was zunächst harmonisch zusammenklingt, hinterlässt Dissonanzen, wenn sich in einem Atemzug Wahrnehmen und Handeln, Genuss und Verantwortung, Autonomie und Engagement überkreuzen. Gehören Kunst und soziales Handeln am Ende doch zwei verschiedenen Bereichen an, die um ihrer selbst willen voneinander getrennt sein sollten?
Die Frage ist alt: Im 18. Jahrhundert war es der Königsberger Philosoph Immanuel Kant, der dem Schönen unter dem Stichwort des „interesselosen Wohlgefallens“ gegenüber dem Guten einen Sonderbereich einräumte und sich die Künste gegenüber Politik und Religion emanzipierten (Fenner). Im 19. Jahrhundert war es der dänische Theologe und Philosoph Søren Kierkegaard, den ästhetischen, ethische und religiöse Lebenshaltungen als drei einander ausschließende Lebensstadien verhandelte (Gerl-Falkovitz). Seither hat sich der Gegensatz zwischen künstlerischer Autonomie und gesellschaftlichem Engagement eingebürgert.
Dabei müssen sich Autonomie und Engagement nicht ausschließen (Leisch- Kiesl). Im Gegenteil, es gibt sie, die Schnittfelder, an denen Schönes und Gutes zueinander kommen: So haben sich die Künste immer wieder thematisch mit sozialen Fragen auseinandergesetzt (Scholz-Hänsel, Pitz). Menschen haben den Künsten im rezeptiven wie im produktiven Sinn therapeutische Kräfte beigemessen (Lätsch, Heimes) und damit andere künstlerisch inspiriert (Röske, Atelier Goldstein). Wieder andere haben mithilfe der Kunst Sozialprojekte durchgeführt (Zinggl/Kuball) oder den Marktwert der Kunst in gute Werke umgemünzt (Ullrich/Langbein, Ostendorf/Werner).
Freilich: Keines dieser Schnittfelder kommt ohne Ambivalenzen aus: Nicht zuletzt, weil mit Blick auf die Darstellung von sozialen Themen Darstellung und Bloßstellung, Problematisierung und Romantisierung nahe beieinander liegen (Scholz-Hänsel, Pitz). Und weil sich die Künste nur bedingt als Therapeutika eignen (Lätsch, Röske) bzw. therapeutisches und künstlerisches Interesse einander im Wege stehen können (Heimes, Atelier Goldstein). Hinzu kommt, dass Künstlerinnen und Künstler keine ausgebildeten Sozialarbeiter sind (Zinggl, Kuball), und auch die wohlmeinendste Benefiz-Kunstauktion nicht umhin kommt, zwischen Markt und Mildtätigkeit zu vermitteln (Ullrich/Langbein, Ostendorf/Werner).
Doch Ambivalenzen bleiben Ambivalenzen – und sind als solche zwei Seiten einer Medaille, die gerade in der kirchlichen Diakoniearbeit fruchtbar werden können (Nolting). Dass dies noch allzu selten geschieht, mag auch daran liegen, dass die Schnittfelder des Schönen und Guten im Schatten des Autonomieverdikts nach wie vor als heikel gelten und der Kampf für den Stellenwert der Ästhetik in Theologie und Kirche seit den 1980er Jahren möglicherweise das Kind mit dem Bade ausgeschüttet hat.
Dass die Lektüre dieses Heftes dazu beitragen könnte, derlei Zögerlichkeiten ein wenig zu lösen, das hofft der Redakteur dieser „kunst und kirche“-Ausgabe und wünscht gute und schöne Lektüre!
Hannes Langbein